Rezension „Blumen für Algernon“ (Daniel Keyes)
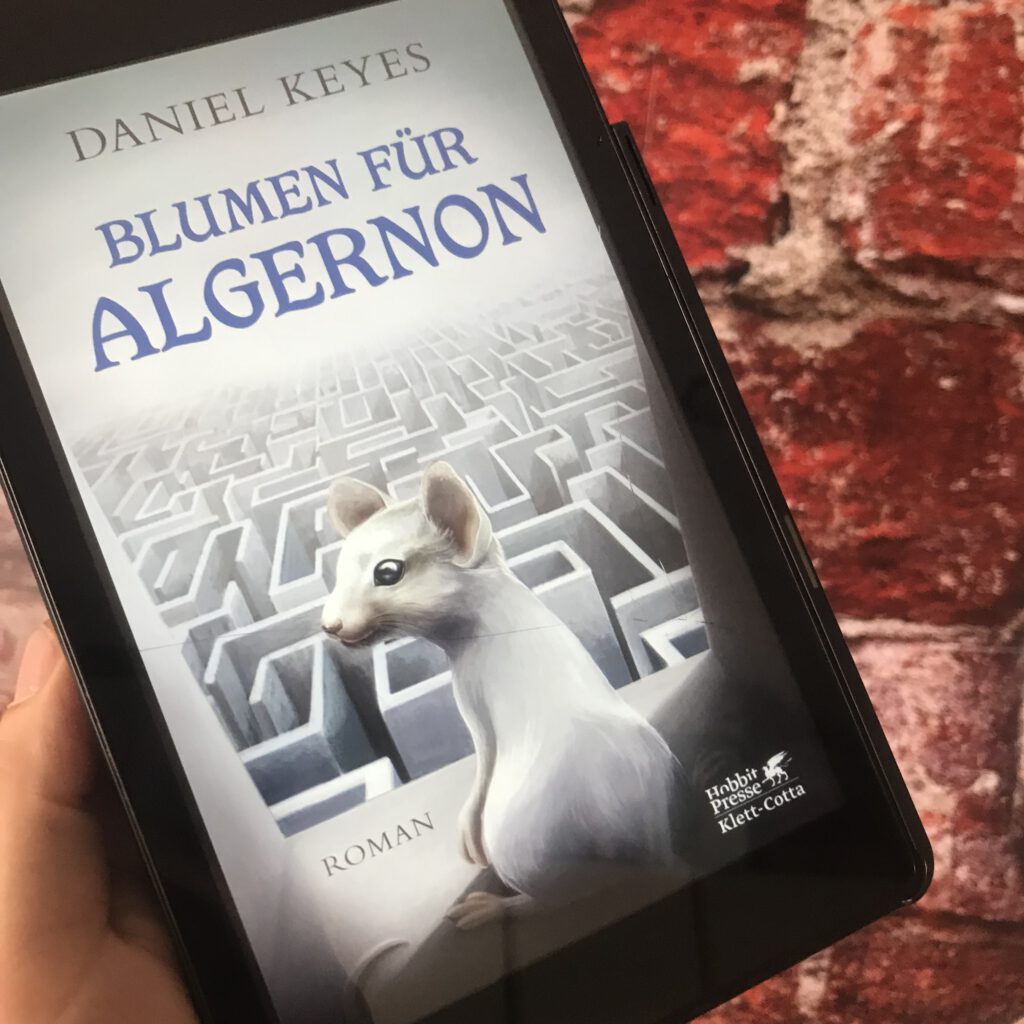
Das größte Kompliment, das einem Roman gemacht werden kann, ist das erneute Lesen. „Blumen für Algernon“ ist dabei ein spezieller Fall, denn wie so viele SF-Klassiker habe ich dieses Werk als Teenager, irgendwann in der zweiten Hälfte der 1990er, kennengelernt. In den Jahren vor und kurz nach dem Millenium, als ein SuB keine Chance hatte, weil ich (gefühlt) pro Tag ein Buch las – und manche davon mehrfach – hat mich die Geschichte von Charlie Gordon und der Maus Algernon einige Male in ihren Bann gezogen. Hätte ich Keyes‘ Roman aus dem Gedächtnis rezensiert, wäre mein Urteil wohl überschwänglich positiv. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Abstand, in denen ich „erwachsen“ wurde, mehr und vielfältig las und mich selbst als Autor versuche, fällt das Lob etwas „gedämpfter“ aus. Dennoch: „Blumen für Algernon“ ist in meinen Augen noch immer eine bemerkenswerteste Erzählung: Explizit nicht als Genre-Literatur.
Charlie Gordon ist 32 Jahre alt und hat einen IQ von 70. Seinen Job als Hilfsarbeiter in einer Bäckerei verdankt er seinem alten Herrn. Was Charlie neben seiner Gutmütigkeit auszeichnet, ist sein unbeugsamer Wille, zu lernen und intelligent werden zu wollen. Dies führt dazu, dass er an einem einzigartigen Experiment teilnehmen darf: Durch eine Gehirnoperation soll sein Intelligenzwachstum angeregt werden, nachdem einige Wochen zuvor ein identischer Eingriff bei der Maus Algernon zu bemerkenswerten Resultaten führte. Das Experiment scheint zu gelingen: Charlie und Algernon übertreffen ihre jeweiligen Leistungen von Tag zu Tag. Während Algernon immer komplexere und gefährlichere Labyrinthe spielend meistert, übertrifft Charlie schon bald auf jedem Gebiet die genialsten Menschen, sobald er sich nur ein wenig mit dem jeweiligen Feld beschäftigt habt. Zum Schluss überwacht und steuert Charlie selbst die Experimente an sich und Algernon – bis sich bei der Maus irrationales Verhalten zeigt …
Was der Leserschaft von Anfang an auffallen wird ist die spezielle Art, wie dieser Roman erzählt wird. Beschrieben wird ein Zeitraum von 10 Monaten, den Keyes von Charlie in Form von „Fortschrittsberichten“ zeitweise täglich festhalten lässt. Natürlich ist die Erzählform – vergl. Brief- und Tagebuchroman – nichts Neues, beeindruckt aber durch seine sprachliche Gestaltung. Zu Beginn des Romans kann sich Charlie weder gut ausdrücken, noch beherrscht er Rechtschreibung und Grammatik. Der erste Satz im Buch: „Forschritsberich 1, 3 Merts: Dr Strauss sagt fon nun an sol ich aufschreiben was ich denke und woran ich mir erinere und ales was ich erlebe.“ Wer jetzt vermutet, Keyes lege einen unleserlichen Roman vor, kann beruhigt sein: Charlie lernt schnell und fabuliert bis zur Mitte des Romans Bericht für Bericht eleganter – strukturell auffällig, rein handwerklich meisterhaft umgesetzt. Generell gilt es als dröge, wenn „berichtet“ statt „szenisch erzählt“ wird. Hier sorgt es jedoch für Spannung, da zunächst – durch die schlichte und eingeschränkte Sichtweise von Charlie – nicht klar ist, was überhaupt passiert. Im weiteren Verlauffesselt der „Seelenstriptease“, den Charlie in seinen Berichten festhält.
Der Umgang der Norm-Gesellschaft mit dem „Anderssein“ ist das bestimmende Thema. Von wenigen Tagen abgesehen ist Charlie in dieser Geschichte immer anders. Anfänglich durch seinen niedrigen IQ, später durch seine beständig fortschreitende Intelligenz: Er wurde gedemütigt und zum Amüsement von denjenigen, die er für Freunde hielt, vorgeführt. Im Verlauf des Buches sorgen seine überragenden geistigen Fähigkeiten für Unbehagen, Neid und schließlich Furcht. Der Roman ist nicht nur eine (berechtigte) plumpe Kritik an all jene, die sich über geistig Zurückgebliebene lustig machen – Keyes konfrontiert uns schonungslos mit all unseren instinktiven Reaktionen auf Abweichungen.
Es ist nicht schwer zu erraten, welchen Verlauf und Ausgang der Roman haben wird. Keyes begibt sich auch gar nicht erst auf ablenkende Fährten, sondern geht konsequent den Weg, den diese Geschichte einfach gehen muss. Die Leser leiden mit Charlie – auch (und vor allem dann), wenn dieser selbst nicht mehr leidet.
Wo der Roman versagt: „Blumen für Algernon“ war ursprünglich eine (längere) Kurzgeschichte. Thema, Aussage sowie Anfang und Ende der Romanfassung sind damit abgedeckt. Und wenn man es ganz hart formuliert, hätte diese brillante Kurzgeschichte nicht unbedingt eine Romanfassung gebraucht. Keyes hatte den Mittelteil dieses Werks auszubauen und das Ganze zu vertiefen. Das gelang ihm stellenweise gut, bspw. mit weniger Brüchen in der Entwicklung von Charlie, mehr Verständnis für das Innenleben seines Protagonisten sowie der Beziehung zu seiner Lehrerin Alice Kinnian, auf die in der Kurzgeschichte nur beiläufig eingegangen wird. Insgesamt hatte Keyes jedoch Schwierigkeiten, dem „Mehr“ an Handlung auch einen sinnvollen „Mehrwert“ hinzuzufügen. Die Entführung Algernons durch Charlie, sein Untertauchen und die Beziehung mit der unkonventionellen Fay sind nicht schlecht geschrieben, doch letztendlich nicht von Relevanz.
Während Keyes‘ Kritik an dem Umgang mit Menschen außerhalb der Norm (leider) nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat – unsere Spezies verändert sich bedauerlich langsam und in sehr kleinen Schritten – , merkt man dem Werk doch an, dass es 56 Jahre auf dem Buckel hat. Das zeigt sich in der Zeichnung der beiden Frauen in diesem Roman, aber auch einer eher gekünstelten Dialogführung, die Natürlichkeit vermissen lässt.
Fazit: „Blumen für Algernon“ kämpft mit Längen im Mittelteil und offenbart sich an einigen Stellen als Kind seiner Zeit. Hingegen begeistert der Roman durch sprachliche Finessen, der eindringlichen Zeichnung seines Protagonisten und einer schmerzhaft zutreffenden Betrachtung der menschlichen Gesellschaft .